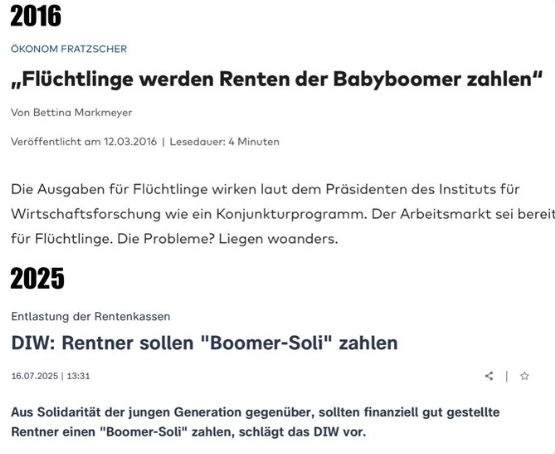Safranski

Verstecken ist aktiviert
Um diesen versteckten Text lesen zu können, musst du registriert und angemeldet sein.
Man hält den Zusammenhalt offenbar für eine Naturtatsache, eine Selbstverständlichkeit, um die man sich nicht eigens kümmern muss, selbst wenn sie gefährdet ist. Mich jedenfalls wundert es, dass der Laden überhaupt noch zusammenhält.
Wie viel Einwanderung aus fremden Kulturen erträgt eine Gesellschaft?
Das weiss ich auch nicht. Aber zuerst einmal muss endlich offen über diese fundamentale Frage geredet werden. Dass das nicht getan wird, weil für manche schon die Frage als fremdenfeindlich gilt, halte ich für eine abgrundtiefe Verantwortungslosigkeit. Durch den Aufstieg der AfD ist das Land nun politisch so polarisiert wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Die etablierten Parteien treiben ein bedenkliches politisches Spiel: Erst drückten sie gegen den Willen der Mehrheit ihre Migrationspolitik durch, dieses Defizit an Demokratie führte zum Aufstieg der Populisten, die man nun wiederum als verfassungsfeindlich hinstellt und zu verbieten versucht.
Sie sprechen vom Zusammenhalt. Was hält eine Gesellschaft zusammen?
In erster Linie geht es darum, dass sich die Menschen in dem Format zugehörig fühlen, in dem sie leben. Hier heisst das Format Deutschland, bei Ihnen heisst es Schweiz. Das hat mit Geschichte zu tun, mit gemeinsamer Sprache, mit Lebensgewohnheiten, mit vielen Dingen, die zur geteilten Lebenswelt gehören, mit denen man sich identifiziert, mit einem auch alltäglichen Kulturstil. Wenn es da zu Krisen kommt, muss offen darüber geredet und politisch gehandelt werden, etwa wenn das ganze Bildungssystem kollabiert, weil in manchen Bezirken 80 Prozent der Schüler nicht Deutsch sprechen. Zum Teil wird das immer noch tabuisiert.
Die Justiz und die Gerichte, insbesondere auch das Verfassungsgericht, sind in den letzten Jahren immer politischer geworden. Wichtige Teile der Politik werden juristisch geregelt und nicht mehr durch Mehrheitsentscheidungen im Parlament. Das ist ein Problem. Wir sehen das jetzt wieder bei dem Urteil, das die politisch gewollten Zurückweisungen von Migranten an der Grenze gestoppt hat. Wenn die Gerichte so politisch entscheiden, muss man sich nicht wundern, wenn es auch politische Debatten über die Besetzung dieser Ämter gibt.
Braucht es für die Wehrhaftigkeit nicht auch ein Mindestmass an Patriotismus, an Heimatliebe, um diesen antiquierten Begriff zu verwenden?
Das ist so. Alle Länder im Westen haben jetzt Schwierigkeiten mit der Wehrhaftigkeit, bei uns in Deutschland verschärft sich das durch unsere nationale Neurose. Es gab ja einmal diese Losung der Grünen: «Liebe Ausländer, lasst uns mit den Deutschen nicht allein.» Natürlich muss man wissen, was man verteidigen will. Es muss einem lohnend erscheinen. Aus historisch nachvollziehbaren Gründen setzt Deutschland dabei nicht auf die nationale Komponente, sondern auf den Freiheitsraum, den es zu verteidigen gilt. Und dieser ist eher europäisch definiert. Doch das ist ein unaufrichtiges Konzept.
Nun erleben wir einen riesigen Feldversuch: Eine an Frieden gewöhnte, wenn man so will: verwöhnte Gesellschaft muss auf einmal wehr- und kriegstüchtig gemacht werden.
Die Schere öffnet sich zwischen dem, was aufgrund der geopolitischen Situation gemacht werden müsste, und der Mentalität bei der grossen Mehrheit. Mit der vorherrschenden Mentalität – das muss man wahrscheinlich so sagen – sind wir nicht verteidigungsfähig.
Die Erfahrung zeigt: Die EU kann bei der Agrarpolitik und in anderen Bereichen unheimlich viel regulieren, aber wenn es richtig hart auf hart geht, wenn es existenziell wird, dann sind wieder die Nationen gefordert. Nehmen wir wieder das Beispiel Ukraine. Da sagen die Spanier und die Portugiesen mit Recht, bei uns werden die Russen nicht einmarschieren. Auch für Frankreich besteht kaum Gefahr, eigentlich auch nicht für Deutschland. In Polen sieht es ganz anders aus, im Baltikum erst recht. Die existenzielle Betroffenheit der Einzelstaaten unterscheidet sich stark, das kommt in Ernstfallsituationen zur Geltung. Auch in diesem Bereich wäre Ehrlichkeit gefragt. Man müsste offen darüber nachdenken, wo man eine zentrale europäische Handlungsmacht braucht und wo die Vielfalt friedlich verbundener europäischer Einzelstaaten. Die gebetsmühlenhaft wiederholte Forderung «Mehr Europa!» verdeckt eher das Problem.
Wer sind die Apokalyptiker?
Ich spreche von einer Geisteshaltung, die vor allem bei den Grünen und in der Umweltbewegung verbreitet ist und unweigerlich zur Forderung nach einem rigiden Durchgreifen des Staats führt. Wer an den Weltuntergang glaubt, hat nicht mehr die innere Freiheit, etwas auszuprobieren, sondern muss autoritär handeln. Deswegen kam es in Deutschland zu dieser vollkommen überteuerten, hoch subventionierten Energiewendepolitik, die dann doch nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Es ist eine kryptoreligiöse Bewegung.
Ein Religionsersatz?
Man merkt das auch am Sprachgebrauch, dass man jetzt bestraft wird für die Sünden, die man als Konsument begangen hat. Politische Akteure spielen sich auf wie Priester bei der Bekämpfung von Dissidenten und anderen Ungläubigen. Wir leben in einer Gesellschaft, die vollkommen entchristianisiert ist, die nicht mehr religiös ist, aber kryptoreligiös. Und die Deutschen haben ein besonderes Talent dafür. Schon der Nationalsozialismus war im Kern eine fatal-religiöse Bewegung. Auch heute noch besteht dieser unerträgliche missionarische Zug, nicht mehr im Sinne aggressiver Eroberung wie bei den Nazis, sondern im Sinne der Erlösung und Weltbeglückung.
Man wird von jetzt an von einer dreiteiligen Ontologie ausgehen müssen. Bisher war immer klar: Es gibt das organische Leben, das sich aufgipfelt bis zum Bewusstsein. Und es gibt die Dinge, also das Anorganische. Nun gibt es noch etwas Drittes, nämlich intelligente Dinge. Maschinenintelligenz, ohne Bewusstsein. Das ist eigentlich ein ungeheurer Vorgang. Wir dachten immer, zum logischen Folgern gehört doch ein Bewusstsein. Nein! Es geht auch ohne. Dieser Aspekt des menschlichen Geistes kann maschinell ausgelagert und dargestellt werden.